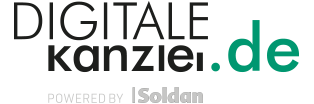Eine inklusive Gesellschaft, in der alle Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen, ist das Ziel in Deutschland und Europa. Ein wichtiger Schritt dorthin ist die Barrierefreiheit. Soweit es um Produkte und Dienstleistungen geht, fördert das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (kurz: BFSG) die gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Einschränkungen und älteren Menschen. Mit dem BFSG wird die EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit (European Accessibility Act, kurz: EAA) umgesetzt. Durch einheitliche EU-Anforderungen soll das Barrierefreiheitsgesetz auch kleinen und mittleren Unternehmen helfen, die Möglichkeiten des europäischen Binnenmarktes auszuschöpfen.
Am 28. Juni 2025 ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft getreten.
Im Gegensatz zum Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), das primär für öffentliche Stellen gilt, betrifft das BFSG auch freiberufliche Anbieter, darunter auch Anwaltskanzleien, wenn sie bestimmte Dienstleistungen anbieten.
Es gilt für Hersteller, Händler und Dienstleister, die bestimmte Produkte und Dienstleistungen für Verbraucher bereitstellen (§ 1 Abs. 2, 3 BFSG). Dienstleistungen des elektronischen Geschäftsverkehrs (§ 2 Nr. 26 BFSG), die auf individuelle Anfrage eines Verbrauchers im Hinblick auf den Abschluss eines Verbrauchervertrags erbracht werden, stehen hier im Fokus.
Das BFSG betrifft also vor allem Online-Angebote und Apps, die zum Kauf von Produkten oder zur Beauftragung von Dienstleistungen genutzt werden: Online-Shops und Plattformen, auf denen mit Verbrauchern Verträge geschlossen werden können. Hierbei ist auch entscheidend, dass Buchungen von Dienstleistungen betroffen sind, deren Leistungen nicht online, sondern offline erbracht werden (z. B. Kauf von Eintrittskarten, Taxifahrten oder Friseurtermine).
Das BFSG gilt nur für den Verbraucherbereich, nicht aber für private und rein geschäftliche B2B-Angebote.
Daher sind Kanzleien, die ausschließlich Unternehmen beraten, nicht betroffen von dem Gesetz. Unter Umständen können Endverbraucher explizit auf der Webseite von einem digitalen Vertragsabschluss ausgeschlossen werden. Dieser Hinweis muss transparent und eindeutig sein. Es muss hinreichend sicher sein, dass die Kanzlei keine Endverbraucher anspricht.
Ausgenommen sind auch Kanzleien (Kleinstunternehmen) im Sinne von § 2 Nr. 17 BFSG mit weniger als zehn Mitarbeitern oder weniger als zwei Millionen Euro Jahresumsatz.
Kanzlei-Webseiten, die nur Informationen abbilden, wie z. B. die Vorstellung des Kanzlei-Teams, die Darlegung von Beratungsschwerpunkten oder Informationen zu Öffnungszeiten, Kontaktmöglichkeiten, Urteilsticker, sind von der BFSG-Pflicht ausgenommen.
Das BFSG findet bei Kanzlei-Webseiten Anwendung, sofern sie einen Verbrauchervertrags-Abschluss offerieren - inklusive einer konkreten Vertragsanbahnung oder einer direkten Mandats-Beauftragung. Hierbei ist entscheidend, ob der Besucher der Webseite online bereits eine Rechtsdienstleistung buchen kann.
Bei folgenden Online-Buchungen muss man von einem Online-Vertragsschluss ausgehen:
- Beratung über Video-Call oder Chat
- Vereinbarung von Beratungsterminen inkl. einer definitiven Termin-Zusage
- Webinar-Buchungen zu juristischen Fragestellungen
- Automatisierte Rechtsberatungs-Tools, wie z. B. Chatbots zur Prüfung von Vertragsinhalten
- Vertrags- oder Datenschutzerklärungsgeneratoren, die individuelle Dokumente ausgeben
- Legal Tech Angebote zur Online-Bearbeitung von Fällen z. B. Hochladen von Dokumenten, Berechnung von Erfolgschancen bestimmter Rechtsstreitigkeiten
Dabei ist es nicht relevant, dass es sich um kostenpflichtige Angebote handelt: Entscheidend ist, dass kostenpflichtige Leistungen das Ziel der Bewerbung sind. Maßgeblich ist, ob ein Rechtsbindungswille hinsichtlich der Leistungserbringung anzunehmen ist. Das dürfte bei bloßen informativen Webinaren oder rein informatorischen Legal Tech-Tools nicht der Fall sein. Werden dagegen Nutzungsbedingungen einbezogen, konkreter Rechtsrat erteilt oder Werbeeinwilligungen abgefragt, liegt ein digitaler Dienst vor.
In der Regel muss im Einzelfall entschieden werden, ob rein werbende Maßnahmen (z. B. Banner oder Newsletter) unter das BFSG fallen. Bei einem klassischen Werbebanner auf der Kanzleiseite ist das nicht der Fall. Führt der Banner allerdings zu einem unmittelbaren Angebot, wird ein konkreter Vertragsabschluss unterstellt, der den Anforderungen des BFSG unterliegt.
Sind Online-Angebote und Apps vom BFSG betroffen, müssen die Inhalte barrierefrei zugänglich sein. Konkret heißt dies, dass das komplette Angebot per Tastatur ohne Maus oder Touchpad vollständig nutzbar sein muss. Außerdem muss es für Bilder, Icons und Schaltflächen Alternativtexte geben sowie die Kompatibilität mit gängigen Screenreadern gewährleistet sein. Beim Layout und der Gestaltung der Angebote sollten ausreichende Schriftgrößen, ausreichende Farb-Kontrast, eine klare, verständliche Navigation, inhaltliche Tastaturbedienbarkeit, überspringbare Abschnitte, sichtbarer Tastaturfokus, ausreichend große Klickbereiche, deskriptive Seitentitel, logisch gegliederte Überschriften und aussagekräftige Linktitel berücksichtigt werden.
Gesetzlich ist ein Melde- und Überwachungssystem durch Marktüberwachungsbehörden vorgesehen für die Einhaltung der Vorgaben vorgesehen. Die Marktüberwachungsstellen der Länder für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen (MLBF) müssen allerdings erst noch geschaffen werden. Bei Verstößen und Nicht-Einhaltung werden Bußgelder verhängt. Nach § 37 BFSG drohen Bußgelder bis zu 100.000 EUR und die beanstandeten Online-Angebote und Apps können auch zwangsabgeschaltet werden. Viele Regeln des BFSG tragen zur Stärkung des Wettbewerbs im Binnenmarkt als Marktverhaltensregel nach § 3a UWG bei. Daher sind Verstöße wettbewerbswidrig und können kostenpflichtig abgemahnt werden, z. B. von Mitbewerbern oder durch Behindertengleichstellungsgesetz anerkannten Verbänden und Einrichtungen.
Grundsätzlich ist Barrierefreiheit aber auch ein starkes Signal für Qualität, Professionalität und soziale Verantwortung – und ein klarer Pluspunkt bei Mandanten, Gerichten und Behörden. Daher sollte man sich als Kanzlei seiner sozialen Verantwortung stellen und ein barrierefreies Angebot über seine Webseite abbilden.
Soldan unterstützt Sie bei dieser Herausforderung gerne. Weitere Informationen auf Webseiten-Gestaltung | Digitale Kanzlei.
Bettina Kauffel ist seit 2012 bei Soldan als Produktmanagerin für Kanzleiservices / Business Development / Legal Tech zuständig. Vor ihrer Zeit bei Soldan hatte sie mehrere Positionen im Marketing/Vertrieb in der Industrie sowie im internationalen Finanzdienstleistungsbereich inne. Einen langjährigen juristischen Bezug hat sie unter anderem durch ihre "Juristen"-Familie.