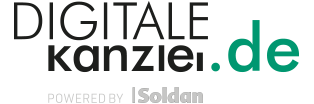Bevor Kanzleien Software mit Künstlicher Intelligenz in ihre Arbeitsabläufe integrieren, sollten spätestens seit Anfang Februar 2025 Maßnahmen zur Sicherstellung von KI-Kompetenz bei Mitarbeitenden getroffen werden.
Die Verpflichtung aus der KI-Verordnung ergibt sich aus folgenden Regelungen:
- Die Anbieter und Betreiber von KI‑Systemen ergreifen Maßnahmen, um nach besten Kräften sicherzustellen, dass ihr Personal und andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI‑Systemen befasst sind, über ein ausreichendes Maß an KI‑Kompetenz verfügen, wobei ihre technischen Kenntnisse, ihre Erfahrung, ihre Ausbildung und Schulung und der Kontext, in dem die KI‑Systeme eingesetzt werden sollen, sowie die Personen oder Personengruppen, bei denen die KI‑Systeme eingesetzt werden sollen, zu berücksichtigen sind.[1]
- „Betreiber“ bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder sonstige Stelle, die ein KI‑System in eigener Verantwortung verwendet, es sei denn, das KI‑System wird im Rahmen einer persönlichen und nicht beruflichen Tätigkeit verwendet.[2]
- „KI‑Kompetenz“ bezeichnet die Fähigkeiten, die Kenntnisse und das Verständnis, die es Anbietern, Betreibern und Betroffenen unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Rechte und Pflichten im Rahmen dieser Verordnung ermöglichen, KI‑Systeme sachkundig einzusetzen sowie sich der Chancen und Risiken von KI und möglicher Schäden, die sie verursachen kann, bewusst zu werden.[3]
Die zuvor erwähnten Maßnahmen müssen seit dem 02. Februar 2025 ergriffen werden.[4]
Welche Maßnahmen zur Sicherstellung oder gegebenenfalls zum Aufbau der entsprechenden Fähigkeiten, Kenntnisse und des Verständnisses ergriffen werden, bleibt den Anbietern und Betreibern überlassen. Auch die Formulierung „nach besten Kräften“ bzw. „to their best extent“ lässt Raum für eine höchst individuelle Ausgestaltung der kompetenzsichernden Maßnahmen. Eine verbreitet angenommene Schulungsverpflichtung steht jedenfalls nicht unmittelbar im Verordnungstext. Gleichwohl wird eine Schulung die naheliegende und in den „besten Kräften“ stehende Maßnahme zur Sicherstellung von KI-Kompetenz sein.
Mögliche Inhalte einer Kanzlei-Schulung in Anlehnung an den KI-Kompetenz Begriff der KI-Verordnung
Um die eigenen Rechte und Pflichten als Nutzer eines KI-Systems im Rahmen der KI-Verordnung richtig einzuschätzen, ist zunächst ein rechtlicher, zusammenfassender Überblick zu Aufbau und Inhalt der KI-Verordnung zu empfehlen. Bei der Selbsteinschätzung hilft die grundsätzliche Unterscheidung des Gesetzgebers zu allgemeinen KI-Modellen mit und ohne systemisches Risiko sowie Hochrisiko-KI-Systemen. Hilfreich können auch (jüngst erschienene) Leitlinien der EU Kommission zur KI-Verordnung sein.
Der rechtliche Überblick für Kanzleien wird zudem die datenschutz- und berufsrechtliche Fragen behandeln.
Für den sachkundigen Einsatz von KI-Systemen in Kanzleien sowie für das Verständnis der Begriffsbestimmungen der Verordnung wird ein gewisses Maß an technischem Know-How erforderlich sein. Dazu zählen Grundbegriffe und Ausprägungen maschinellen Lernens sowie die Unterschiede zur klassischen Programmierung.
Mit einem grundlegenden rechtlichen und technischen Verständnis lassen sich Risiken und mögliche Schäden durch KI erkennen und adäquate Schutzmaßnahmen ableiten. Für das Erkennen der Chancen und Potentiale für die eigene Kanzlei eignet sich ein allgemeiner Überblick zu Anwendungsfällen für KI im Rechtsdienstleistungsumfeld sowie das Betrachten einzelner, konkreter Lösungen in Bereichen wie Entwurfserstellung, juristische Recherche, Dokumentenanalyse oder Übersetzungen.
Andere Möglichkeiten zur Sicherstellung von KI-Kompetenz
Die genannten Fähigkeiten, Kenntnisse und das Verständnis für KI müssen nicht zwingend aufgebaut werden. Denkbar ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer von KI-Systemen bereits über KI-Kompetenz verfügen. Für diesen Fall müsste diese Kompetenz in irgendeiner Form erhoben werden.
Praktikabler und standardisierend in einer Kanzlei ist jedoch der stete Kompetenzaufbau. Als Alternative oder Ergänzung zur Schulung kommen hier kanzleieigene KI-Leitlinien in Betracht, externe Zertifizierungen wie z.B. die des KI-Managers oder die Aufnahme des Themas in ein vielleicht schon vorhandenes Wissens- oder Compliancemanagement.
Sicherstellen von KI-Kompetenz als Sorgfaltspflicht
Im Verordnungstext sind bei Pflichtverstößen gegen Art. 4 KI-VO keine Nachteile für Betreiber ersichtlich. Ob und wann es in Zukunft durch den deutschen Gesetzgeber Sanktionen geben könnte, ist ungewiss. In Haftungssituationen könnte aber eine Sorgfaltspflichtverletzung in Betracht kommen, wenn Kanzleien keine Vorkehrungen getroffen haben, dass Mitarbeitende die notwendige Kompetenz zur Nutzung von KI-Systemen haben.[5]
[1] Art. 4 KI-VO
[2] Art. 3 Nr. 4 KI-VO
[3] Art. 3 Nr. 56 KI-VO
[4] Art. 113 KI-VO
[5] Martini/Wendehorst/Wendehorst, KI-VO Art. 4 Rn. 6, 1. Aufl. 2024
Christian Rekop leitete von 2007 bis 2020 den Bereich Wissen und Recherche bei Soldan, seit 2021 ist er Leiter Business Development, Legal Tech und Services. Christian Rekop ist Dozent für Legal Tech und Legal Operations an der FOM Hochschule. Vor seiner Zeit bei Soldan hat er an der Ruhr-Universität Bochum das Studium Rechtswissenschaft belegt, mit dem ersten juristischen Staatsexamen 2006 abgeschlossen und nach dem weiterführenden Studiengang Wirtschafts- und Steuerrecht den Abschluss Magister Legem (LL.M.) erworben. Seit 2025 ist Christian Rekop IHK-zertifizierter KI-Manager.